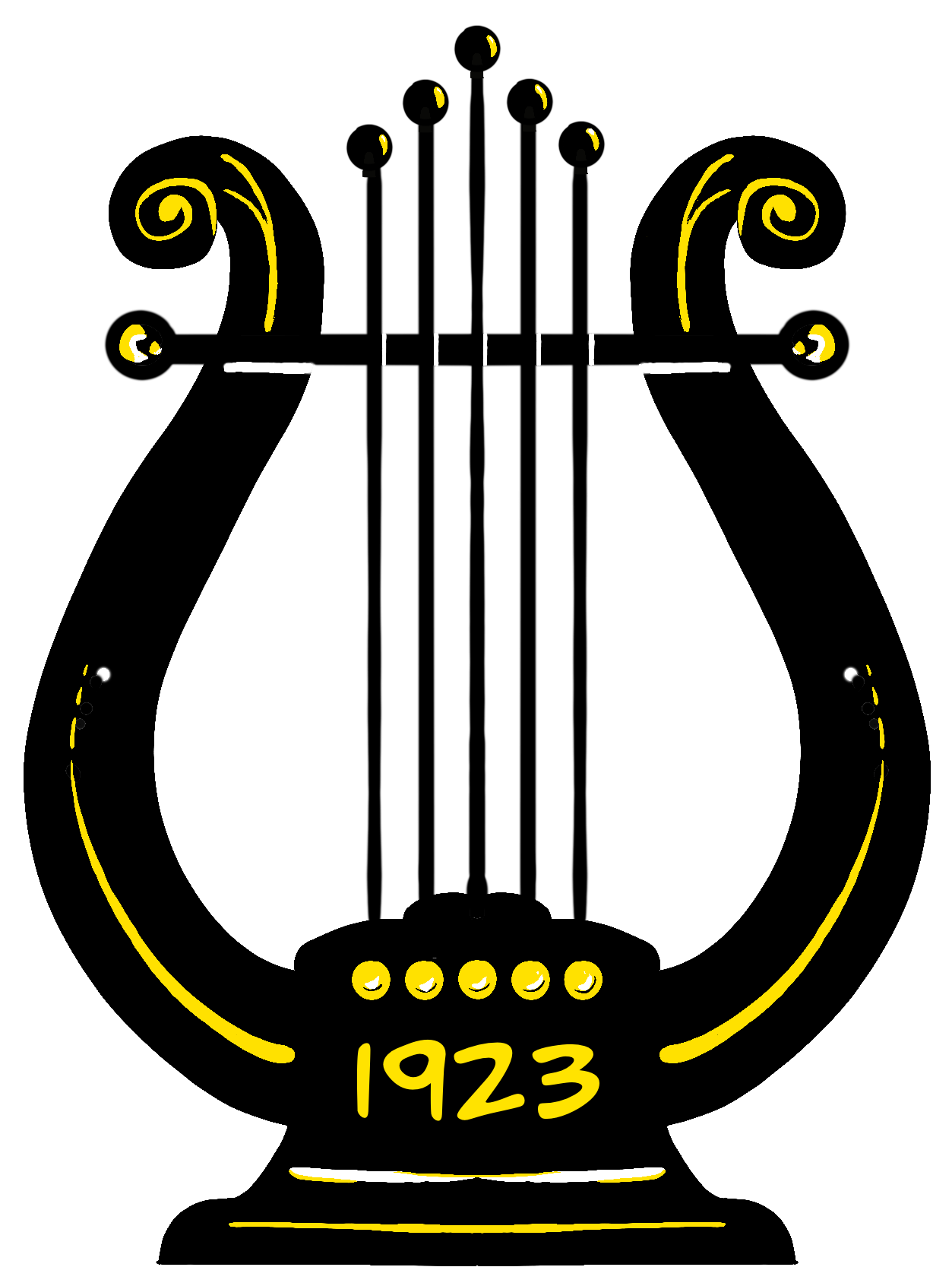Schriesheimer Ärztin Berglind Olafsdottir ist drei Monate lang für „Ärzte ohne Grenzen“ in einem Überschwemmungsgebiet des Südsudan.
Schriesheim. Als sie ankam, war nicht viel zu sehen. Erst beim Rückflug machte Berglind Olafsdottir aus dem Fenster die Aufnahme, die das Camp Bentiu in voller Größe zeigt. 100 000 bis 120 000 Menschen leben hier – ihre Patienten, denn die Medizinerin hatte sich für einen dreimonatigen Einsatz bei der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ gemeldet.

Die riesige Fläche sieht aus wie eine exakt quadratische Insel, mitten in einem grünen Meer. Vor den Überschwemmungen war das Gebiet im Norden des Südsudan trocken, die Bewohner lebten von der Viehzucht. Nachdem der Weiße Nil alles überflutete, retteten sie sich in das Lager, das ursprünglich für Bürgerkriegsflüchtlinge gebaut wurde.
Bittere Armut
Krieg und Hunger hätten hierzulande Mitgefühl geweckt, doch ist es still geworden um die Region. Olafsdottir sagt: „Es ist eine vergessene Krise.“ Die sich aber dramatisch auswirkt auf das Leben der Menschen; viele kamen mit wenig mehr als dem eigenen Leben, leben zum Teil in großer Armut: „Manche haben nicht mehr als eine Garnitur Kleidung.“ Sie leben in Unterkünften aus Bambusstäben und Planen. Diese Not war ein Beweggrund für die Isländerin, sich zu dem Einsatz zu melden, von dem sie jetzt im Gespräch mit der Lokalredaktion berichtet.
Seit dem Abschluss ihrer Ausbildung 2007 hat sie im Krankenhaus gearbeitet und sich im vergangenen Frühjahr bei der Organisation beworben – unter anderem auch, weil sie frustriert war vom deutschen Gesundheitssystem, das sie als profitorientiert erlebte: „Ich wollte an einen Ort, wo das, was ich tue, wirklich einen Unterschied macht.“ Gesucht werden ausgebildete Mediziner und Pflegekräfte; Chirurgen, Gynäkologen und Anästhesisten müssen Fachärzte sein.
Bevor es losging, bekam die 47-Jährige alle nötigen Impfungen, Visa wurden beantragt, sie führte Gespräche mit ihrem Mann und den beiden Söhnen, die hinter ihr standen. Im Sommer kam die Zusage, im September ging es los. Nach einer mehrtägigen Einführung in der Hauptstadt Juba hob sie mit einer kleinen Propellermaschine ab in Richtung Camp.
Das dortige Krankenhaus hat 175 Betten und Probleme, die man in Europa nicht kennt: Bis zu drei Stationen kümmern sich ausschließlich um unterernährte Kinder, es gibt Fälle von Typhus. Ein Auto hat hier niemand; die Patienten werden mit Schubkarren gebracht, begleitet von einem Familienmitglied, das während ihres Aufenthalts für Essen sorgt und Pflege-Aufgaben übernimmt. Es gebe viele Brandverletzungen, erklärt Olafsdottir: „Das ist ganz ähnlich wie bei uns; da fasst ein Kind etwas Heißes an, und schon ist es passiert.“
Zwischen sechs bis zehn Operationen standen täglich an, außerdem wurden Wunden gespült und Verbände gewechselt. Der OP war in Containern untergebracht, steril, klimatisiert, hin und wieder gab es improvisierte Vorrichtungen, die aber trotzdem ihren Zweck erfüllten. Mancher kleine Patient war schon länger da, und Olafsdottir begleitete seinen Heilungsprozess. Krankengymnastik gab es nicht, um ihn zu mobilisieren; deshalb mussten die Gliedmaßen unter Narkose gedehnt werden.

Es hätten sich Bindungen entwickelt, auch wenn es dauerte, bis man mit den sehr stolzen Einheimischen warm wurde. Doch dann sei das Verhältnis herzlich gewesen, sagt die Ärztin. Etwa zu dem sechsjährigen Jungen mit den schweren Verbrennungen oder zu der Zwölfjährigen mit dem Schlangenbiss. Tagelang war das Kind unterwegs, die Wunde infizierte sich, und als sie in der Klinik ankam, hatte sie eine Blutvergiftung. Um ihr Leben zu retten, musste das Bein bis zum Hüftgelenk amputiert werden. Das Mädchen sei trotzdem guter Dinge gewesen, berichtet Olafsdottir. Doch oft sagt sie Sätze wie diesen: „Es ist traurig, vieles wäre vermeidbar gewesen.“
Von der Außenwelt abgeschnitten
Wie der Eingriff bei dem Mann, der mit einem nekrotischen Arm in die Notaufnahme kam: Er ließ eine harmlose Verletzung von einem traditionellen Heiler behandeln, der die Haut einritzte; die Schnitte infizierten sich, am Ende musste der Arm abgenommen werden.
Im Camp gab es Dolmetscher, die die lokale Sprache Nuer sprachen, den Helfern aber auch Zettel mit den wichtigsten Sätzen wie „Öffnen Sie die Augen“ oder „Luft holen!“ schrieben.
Apropos Sprache: Es gab hin und wieder Konflikte mit einem anderen Stamm, und so mussten auch Verletzungen nach Auseinandersetzungen behandelt werden.
Insgesamt 25 Ärzte kamen aus Großbritannien, Dänemark, den USA, Kanada oder Indien. Untergebracht waren sie in einfachen Hütten mit Plumpsklo, doch gab es immer die Möglichkeit, mit den Familien daheim Kontakt aufzunehmen und sie auch per Facebook auf dem Laufenden zu halten. In der Freizeit wurde Volleyball gespielt, es gab Yoga, Filmabende und vieles mehr. Viele Kollegen waren auch Einheimische; neben ihrer Arbeit im OP gab die Anästhesistin Fortbildungen: „Denn es ist die Idee des Krankenhauses, dass es langfristig nur von Einheimischen betrieben werden soll.“ Schon jetzt gab es 500 sudanesische Angestellte, von denen viele hervorragend qualifiziert gewesen seien.
Olafsdottirs Dienst fiel in die Regenzeit, und in diesen Monaten stieg der Wasserspiegel um das Camp dramatisch. Anfang Oktober brach ein Damm: „Wäre das Camp überschwemmt worden, hätte das das Ende für viele Menschen bedeutet.“ Jetzt war das Lager von der Außenwelt abgeschnitten, Flugzeuge konnten nicht landen. Danach war ein eingeschränkter Flugverkehr möglich, doch jetzt brachen die Masern aus. Drei kleine Patienten starben, zwei im Kleinkindalter. Wegen der Nachschubprobleme wurden statt Lebensmitteln Impfstoffe transportiert, und wochenlang gab es nur Reis und Bohnen zu essen. Das hätten aber alle gern in Kauf genommen, betont sie.
Denn in derselben Zeit stellten die Helfer eine erstaunliche Impfkampagne auf die Beine: Überall im Lager wurden mobile Stationen aufgebaut und in nur sechs Tagen 30 000 Kinder geimpft. Noch immer ist Olafsdottir stolz auf diesen Erfolg. Kurz vor Weihnachten war ihr Einsatz beendet; sie kam heim und fühlte sich erst einmal fremd.
Als Nächstes würde sie gerne wieder nach Afrika reisen, gerne nach Nigeria, wo es ein Zentrum für die Behandlung einer heimtückischen Tropenkrankheit gibt: „Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Es ist alles offen.“
Fest steht nur, dass die Medizinerin wieder in einem Land arbeiten möchte, wo das, was sie tut, einen Unterschied macht.
Hungersnot und Überschwemmung
Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts zum Südsudan könnten beunruhigender nicht sein. „Terroristische Anschläge können nicht ausgeschlossen werden, auch an bei Ausländern beliebten Orten“, heißt es da. Die Behörde stuft die Sicherheitslage als instabil ein, zum einen wegen lokaler, regionaler und nationaler Konflikte, zum anderen wegen der hohen Kriminalitätsrate und, was Ausländer angeht, einer großen Entführungsgefahr.
Außerdem sei das Land „gekennzeichnet von der weltweit schlimmsten Hungerkatastrophe“. Im Human Development Index nimmt das Land den allerletzten Platz ein und landet auf Rang 191. Dafür sind Faktoren wie Lebenserwartung, Bildungs- und Einkommensindex maßgeblich. Zwölf nationale Fluggesellschaften stehen zudem auf einer schwarzen Liste, die für die EU nicht zugelassene Airlines aufführt.
Die desolate Situation ist zum einen zurückzuführen auf den Bürgerkrieg, in dem zwischen 2013 und 2018 um die politische Vorherrschaft gekämpft wurde. Mit Beginn der Regenzeit im vergangenen Jahr kam die Flutkatastrophe hinzu, von der nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bis zum Spätjahr eine Million Menschen betroffen waren. 6,6 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung, haben nicht genug zu essen
Interview SK
Quelle: Weinheimer Nachrichten – 11.02.2023