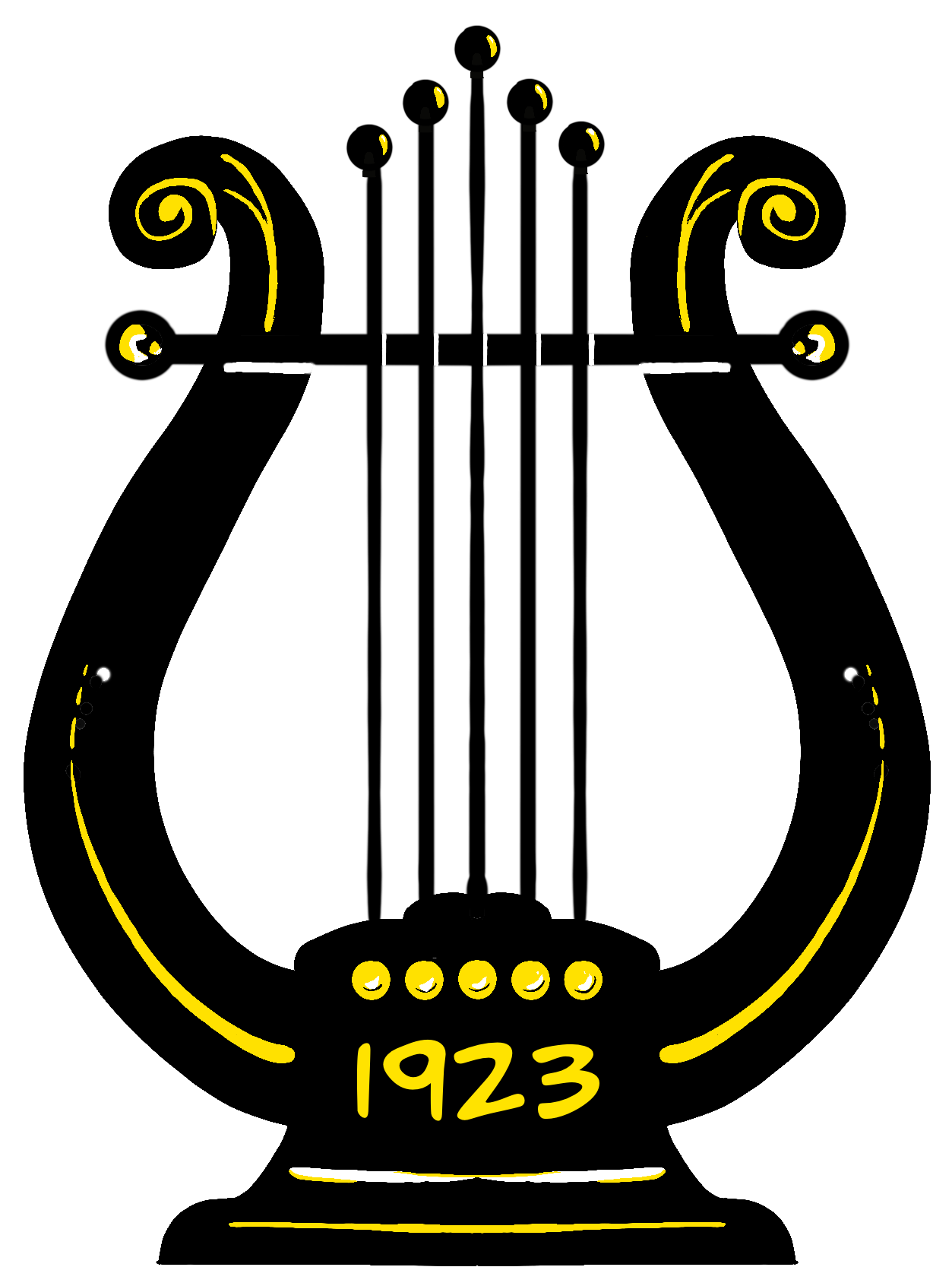Vor einigen Jahren hatte die Lyra an ihrer Adventsfeier das US-amerikanische Spiritual „Kum ba yah, my Lord“ gesungen. Durchaus einige haben dann hinterher gefragt, dass das doch ein eigenartiges Englisch sei und was „Kum ba yah“ eigentlich bedeute. „Kum ba yah“ bedeutet „Komm her!“ und stammt aus dem „Gullah“. Gullah ist eine Mischsprache aus Krio, einer afrikanischen Stammessprache aus Sierra Leone, dem Englischen, einigen spanischen Worten und Einflüssen aus der Sprache der indianischen Seminolen. Wahrscheinlich haben sich Krio und Seminolen gegenseitig sprachlich beeinflusst. Denn Krio-Sklaven flüchteten in die Sümpfe Floridas und vermischten sich mit diesen, ebenso wie Seminolen versklavt wurden und sich mit schwarzen Sklaven familiär verbanden. Daher wird auch heute noch Gullah gesprochen, und zwar in den Südstaaten, in die Krio gebraucht wurden und die Seminolen lebten: North und South Carolina, Georgia und Florida. Und auch nicht im ganzen Gebiet dieser Staaten, sondern hauptsächlich an der Küste, im Marsch- und Sumpfland, wo die Menschen auch heute noch vom Holzfällen, Reisanbau und Fischfang eher ärmlich leben. Da Sierra Leone schon ab dem 16. Jahrhundert ein Stützpunkt des britischen Sklavenhandels war, entwickelte sich das Krio zu einer Art „Pidgin-Englisch“. Im Englischen bedeutet „Ich heiße James“ – „my name is James“, im Krio, später Gullah wurde daraus „Mi nem Jemz“. Oder aus „How are you?“ (Wie geht es Dir?) wird „Aw di body?“ – wörtlich „wie geht es Deinem Körper“ – wobei das englische Body für Körper übernommen wurde. Und so weiter. Tatsächlich ist Gullah für Außenstehende schwer zu verstehen, weil beim Sprechen ganze Silben verschluckt werden. Dahingehend haben wir Glück, dass nur das Intro des Liedes in Gullah blieb und ansonsten auf Englisch gesungen wird. Der Text ist recht einfach. In der ersten Strophe wird dreimal wiederholt: Kumbaya, my Lord, kumbaya. Also auf gut Deutsch: Komm hier zu mir, Herr. In der zweiten Strophe wird dreimal wiederholt: Someone’s crying, Lord, kumbaya! Deutsch: Jemand oder man weint, mein Herr. In der dritten Strophe wird dreimal wiederholt: Someone’s singing, Lord. Deutsch: Jemand oder man singt, mein Herr. In der vierten Strophe heißt es: Someone’s praying, Lord. Deutsch: Jemand oder man betet, mein Herr. In der fünften Strophe wird gesungen: Jemand oder man schläft, mein Herr. Und in der sechsten und letzten Strophe wird der Herr aufgefordert zu hören, wie jemand oder man singt. „Hear me singing, Lord“. Was ist der Sinn dieses Liedes?
Nun, wer einen US-afroamerikanischen Gottesdienst oder einen Gottesdienst in Afrika selbst erlebt hat, weiß, dass die Lieder dort eine Trennung der Seele von den Bürden des Alltags unterstützen sollen, eine Hinwendung der oder des Einzelnen zum Esoterischen, Göttlichen, eine Erschaffung von Harmonie, Frieden und Hoffnung. Dies geschieht natürlich nur dann, wenn die Sängerin oder der Sänger selbst bereit ist, aus sich und ihrem Alltag herauszutreten. Sich emotional zu engagieren, den tieferen Sinn in Text und Melodie zu erkennen und die Hemmungen abzustreifen, sondern ganz bei sich zu sein. Dies geschieht durch höhere Lautstärke, permanente Wiederholung, Stampfen, Klatschen, Einsatz von Trommeln und anderen Instrumenten. Der Verlust von Heimat und Freiheit, das Dasein in ewiger monotoner Arbeit, Hunger und Sklaverei kann nie vergessen werden, aber das Lied am Sonntag hilft, wie eine Art Therapie dennoch einen Fetzen Lebensfreude und Hoffnung auf Verbesserung und Erlösung zu erhalten. Der Herr soll sehen, wie sein Volk weint, singt, betet, schläft. Im Grunde genommen ist das Leben für Sklaven ein ewiger Schlaf, denn sie können ihre eigene Persönlichkeit nicht zum Erwecken bringen. Ihre Wünsche und Begabungen zählen nicht. Und nur das Singen und Tanzen ist Ihnen von einer Art eigenem Leben geblieben. Daher ist auch die Sprache in allen Spirituals fundamental, sie legt direkt den Finger auf die Wunde und auf die Traurigkeit, sie ist direkt, unverstellt, sofort zu begreifen. Sie ist nicht aufrührerisch, denn zu viele haben mit dem Leben für Flucht und Auflehnung bezahlt. Sie fordert keine Rache, keine Revanche, keine Vergeltung. Die Sprache schwankt zwischen Resignation, Wünschen und Hoffnung, ist voller und tiefer Emotion. „Somebody“ steht für „Jemand oder man“. Wenn wir nicht „ich“ sagen wollen, weichen auch wir alle auf „man“ aus. Wir entpersonalisieren also unsere Wünsche. Dennoch sind die Wünsche da. Komm zu mir Herr und erlöse mich. Denn die Menschen tun es nicht. Daher muss das Lied selbst sehr, sehr alt sein. Vielleicht sogar Jahrzehnte vor dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861-65). In den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurde dieses Lied zur Hymne der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Bei den Märschen von Martin Luther King wurde das Lied gesungen. Die Folksängerin Joan Baez hatte es im Repertoire. Der Folksänger Pete Seeger spielte es oft. Als gesichert gilt, dass die erste Aufnahme des Liedes 1926 in North Carolina vom Folksong-Forscher Robert Winslow Gordon auf Wachszylinder gemacht wurde. Weil aber Melodie und Text schlicht sind, wurde der Song in den Neunzigerjahren zum Synonym für eine naive Harmoniesucht, die vor allem der progressiven Linken mit ihren Träumen vom Weltfrieden zugeschrieben wurde. Wie so oft sucht sich daher eine Melodie neue Sängerinnen und Sänger. Ob diese allerdings die emotionale Tiefe erahnen können? Es wäre zu hoffen, jedoch: 2001 wurde das Lied in einer Aufnahme von Michael Mittermeier vs. Guano Babes unter dem Titel Kumba yo! auch als Musikvideo herausgegeben. Im Dezember 2006 legte es Mickie Krause als Stimmungsschlager neu auf. Der Titel des Liedes wird zudem im englischsprachigen Raum oft auch sarkastisch verwendet, um entweder die Spiritualität und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verspotten oder um deren Oberflächlichkeit zu kritisieren. Nun ja, das ist natürlich vom Ursprung sehr weit entfernt.